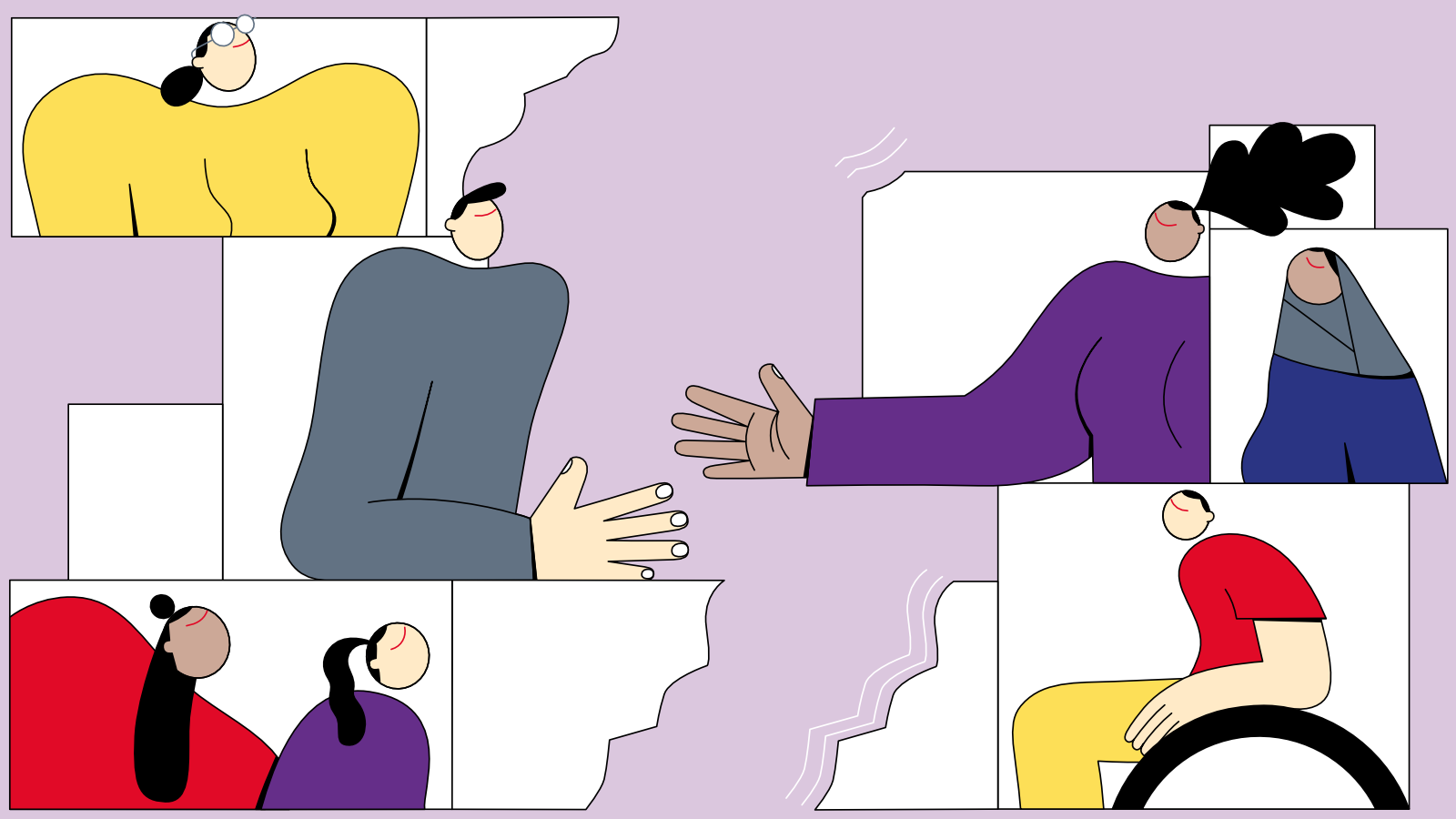Wie wir den sozialen Zusammenhalt stärken können
Die Akzeptanz von Vielfalt in Deutschland nimmt ab, gleichzeitig wächst die Polarisierung. Wenn wir als Gesellschaft krisenfest werden wollen, müssen wir dem entgegenwirken, argumentiert Ottilie Bälz, Leiterin unseres Fördergebiets Globale Fragen.
Wir leben in bewegten Zeiten. Krisen und Kriege brechen in unvorhergesehener Häufung über uns herein. Gefühle von Überforderung, Ermüdung und Verunsicherung nehmen zu. Der voranschreitende demographische Wandel, Zuwanderung aus anderen Teilen der Welt und das selbstbewusstere Auftreten einst wenig sichtbarer oder marginalisierter Gruppen tun das ihrige, um diese Gefühle in nennenswerten Teilen der Bevölkerung weiter zu verstärken.
Die Reaktion ist häufig eine Rückbesinnung auf das Eigene in Abgrenzung vom Anderen oder Fremden. Sie geht einher mit einer Verengung der Perspektive und kann dazu führen, dass einzelne gesellschaftliche Gruppen für komplexe gesellschaftliche Problemlagen verantwortlich gemacht werden.
Befinden wir uns in einem neuen Kulturkampf?
Die Akzeptanz von Vielfalt in Deutschland zuletzt deutlich abgenommen, wie die Studie Vielfaltsbarometer unserer Stiftung zeigt. Hat die Mehrheit der Bevölkerung Vielfalt vor einigen Jahren noch sehr deutlich als Bereicherung wahrgenommen, steigt inzwischen die Zahl der Skeptiker:innen. Noch ist das kein Grund zu Alarmismus. Es scheint sich aber eine Tendenz für eine zunehmende gesellschaftliche Polarisierung abzuzeichnen. Besonders deutlich werden diese Gräben zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen bei der Akzeptanz verschiedener sexueller Orientierungen, ethnischer Vielfalt oder Religion. Damit bestätigt die Studie empirisch, was öffentliche Debatten uns ohnehin schon haben erahnen lassen.
Ist diese Entwicklung, die von vielen als wiederaufflammender Kulturkampf wahrgenommen wird, selbstverschuldet? Haben wir es womöglich übertrieben mit der Identitätspolitik? Verlieren wir deshalb immer mehr Menschen für das Projekt einer vielfältigen Gesellschaft, die wir ohnehin schon sind und zukünftig noch mehr sein werden?
Der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama analysierte 2019 in seinem Buch „Identität“, worum es bei Identitätspolitiken geht und was die Konsequenzen sind. Er beschreibt, wie sich in zunehmend fragmentierten und diversifizierten Gesellschaften die politische Linke für benachteiligte Gruppen wie ethnische Minderheiten, Frauen oder die LGBTQI-Community einsetze, während die politische Rechte im Gegenzug für Patriotismus und den Schutz traditioneller nationaler Identität eintrete. Ehemals klassische Großmilieus, wie die Arbeiterschaft, würden sich dabei häufig nicht mehr ausreichend in ihren Interessen berücksichtigt sehen. Am Ende aber ginge es für all diese Interessensgruppen um dasselbe: um Anerkennung, Zugehörigkeit und Würde. Die Daten des Vielfaltbarometers könnten darauf hinweisen, dass Fukuyamas Analyse richtig war und wir aktuell mit den Konsequenzen umgehen müssen.
Eine eigene Identität und Empathie für andere gehören zusammen
Wie kann es gelingen, Anerkennung für jede und jeden Einzelnen zu sichern, ohne dass dies über die Abwertung anderer Gruppen geschieht? Wir müssen lernen, uns aufeinander einzulassen und Unterschiede auszuhalten.
Wichtige Voraussetzung dafür, auch das zeigt das Vielfaltsbarometer, ist die eigene Empathiefähigkeit. An ihr kann man arbeiten – durch Begegnung mit Menschen, die ganz anders sind als man selbst oder die Bereitschaft, sich in die Lebenssituation anderer hineinzuversetzen. Dazu gehört auch, eigene Betroffenheit nicht zum alleinigen Maßstab zu nehmen und eine Gruppe nicht höher zu stellen oder ihr mehr Rechte zuzugestehen als einer anderen. Ethnische Vielfalt zu befürworten und gleichzeitig Homosexualität abzulehnen, ist keine wirkliche Akzeptanz von Vielfalt.
„Vielfalt ist eine Tatsache und wird unsere Gesellschaft in Zukunft noch stärker bestimmen als bisher.“
Wir leben – zu unser aller Glück – in Zeiten und in einem Land, wo verschiedenen Gruppen ihre Anliegen frei äußern und ihre Rechte aktiv einfordern könne. Das dürfen sie nicht nur tun, sie sollten ausdrücklich darin unterstützt werden. Dass das für andere Menschen unbehaglich sein mag, müssen wir ertragen. Zum Aushalten gehört auch anzuerkennen, dass nicht die ganze Welt aus Vielfaltsexpert:innen besteht – manche Menschen werden unwissentlich falsche Begriffe verwenden und trotz bester Absicht in sprachliche Fettnäpfchen treten oder diskriminieren. Für Betroffene kann das schmerzhaft sein, ganz vermeiden lässt es sich nicht. Zugleich haben individuelle Freiheiten und Verhaltensweisen dort ihre Grenzen, wo die Rechte anderer beschnitten werden.
Vielfalt als Gemeinschaftsaufgabe – wir alle sind in der Pflicht
Vielfalt ist eine Tatsache und wird unsere Gesellschaft in Zukunft noch stärker bestimmen als bisher. Die Akzeptanz von Vielfalt in all ihren Facetten ist nicht nur Voraussetzung für ein gutes Zusammenleben, sondern stärkt den Zusammenhalt, wie das Vielfaltsbarometer nachweist. Sie trägt auch dazu bei, uns als Individuen und als Gesellschaft krisenfester zu machen. Um das zu erreichen, sind wir alle in der Pflicht: Zivilgesellschaft, Medien, Politik.
Gemeinsam sollten wir den Dialog miteinander suchen und mehr Wissen über andere gesellschaftliche Gruppen aufbauen. Gemeinsam sollten wir unsere Demokratie stärken, unsere Werte verteidigen, gegen jede Form der Diskriminierung angehen und Intoleranten ihre Grenzen aufzeigen. Gemeinsam sollten wir mehr Wertschätzung füreinander aufbringen, auch für die individuelle Lebensleistung. Und gemeinsam sollten wir auf Pauschalisierungen, Stereotypisierungen und Vorverurteilungen ganzer Bevölkerungsgruppen verzichten. Als Robert Bosch Stiftung versuchen wir durch Dialog-und Begegnungsformate, Wissensvermittlung und auf empirischen Daten basierenden Wortmeldungen unseren Beitrag dazu zu leisten.